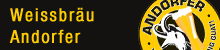Brennpunkt | Saturday, 20. March 21
Das Märchen vom sauberen Atomstrom
1957 ging in München-Garching der erste deutsche Atomreaktor in Betrieb. Die „saubere Atomenergie“ hat uns ein schwieriges Erbe hinterlassen....
Bürgerblick Plus
Unabhängiger Journalismus ist abhängig von zahlenden Lesenden
Hinweis fürs Finanzamt: Zahlungseingänge werden wie Abozahlungen verbucht. Bürgerblick als gemeinnützige Gesellschaft zu etablieren ist in Arbeit. |
08:07
Donnerstag
19. Februar 2026
PRIVATE PLATTFORMEN19.02. | Thursday REDOUTE Liebesgedichte  Gedichte zur Liebe aus mehr als zwei Jahrtausenden: über erfüllte, verlorene und enttäuschte Liebe sowie über Erotik, Sexualität und unterschiedliche Lebensentwürfe. Vom Schauspielensemble des Landestheaters. 19:30 Uhr | ab 16 Euro CAFÉ MUSEUM New-Orleans-Jazz  Die New Orleans Brass spielt Klassiker und moderne Songs im Stil der New-Orleans-Brassbands. Mit Barney Girlinger, Paul Zauner, Ali Angerer und Daniel Stockhammer. 20:00 Uhr | ab 7 Euro
|